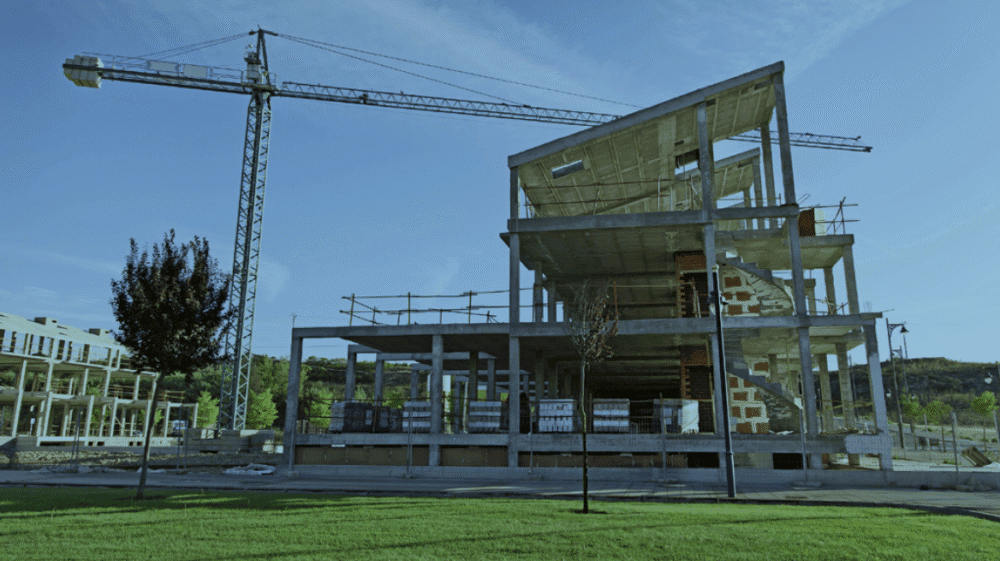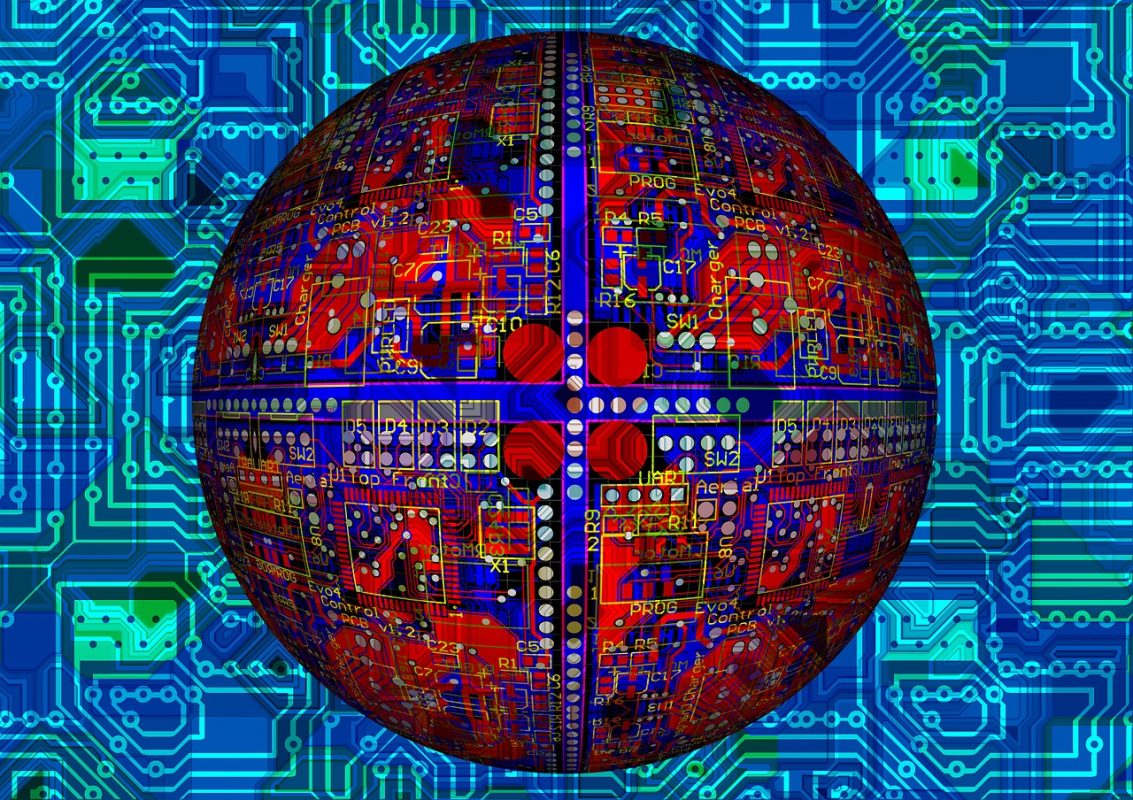Rückblick 105. Schweizer Immobiliengespräch
Wohin führt die Regulierung des Schweizer Wohnungsmarkts? Sind die Folgen immer die gewünschten? Und was kann die Immobilienwirtschaft tun, um nicht als Gegenspieler des Gemeinwohls dazustehen? Ein hochrangig besetztes Panel ging diesen Fragen unlängst im Zürcher «Metropol» nach.

Mit prominenten Speakern aus Wissenschaft, Privatwirtschaft und Politik widmete sich die 105. Ausgabe der «Schweizer Immobiliengespräche» dem Zusammenhang von Regulierung und knappem Wohnungsangebot. Die Liste der Markteingriffe, mit denen die Politik das Wohnungsproblem in den Griff bekommen will, wird wahrscheinlich länger werden. Initiativen auf Bundes- wie auf kantonaler Ebene könnten zu einem Mietpreisdeckel führen, sogar eine Verfassungsänderung ist im Gespräch und diskutiert wird zudem die Einführung von Vorkaufsrechten sowie die Verschärfung der Lex Koller. Moderator Christian Kraft von der Hochschule Luzern zeigte in seinem Eingangsstatement, dass die bestehende Regulierung mitverantwortlich für die exorbitant gestiegenen Angebotspreise ist. Auch ist wissenschaftlich belegt, dass «Rent-Control» sowie der Schutz von Mietern im Bestand mittelfristig zu mehr hochpreisigem Angebot fühen – und langfristig zu grosser Ungleichheit und Druck auf die mittleren Einkommensklassen.

«Wir sind Teil der Lösung»
Auf die kontraproduktiven Folgen regulatorischer Eingriffe auf den Marktmechanismus verwies auch Marcel Kucher, CFO und designierter CEO der Swiss Prime Site. Er machte in seinem Vortrag andererseits deutlich, dass die Immobilienbranche offen ist für klare Regeln und sich als Teil der Lösung für mehr bezahlbaren Wohnraum sieht. Eine Regelung, mit der die Branche nach seinem Ermessen gut und gerne leben könnte: Höher und dichter bauen gegen feste Quoten für bezahlbare Wohnungen.

Dieser und andere Vorschläge, die Kucher machte, tauchten interessanterweise im Vortrag von Markus Bärtschiger, dem Stadtpräsidenten von Schlieren, wieder auf. Der SP-Politiker forderte zur Linderung der Wohnungsknappheit unter anderem die Lockerung des Lärmschutzes, eine effizientere Regelung von Einsprachen und die Erleichterung von Umnutzung. Freilich hatte Bärtschiger auch Ideen im Gepäck, die in eine andere Richtung weisen: Die Besteuerung leerstehender Wohnungen etwa, mehr staatlichen Wohnungsbau, und – last but not least – auch Einflussnahme auf die Mietpreise. Regulierung sei leider notwendig, so Bärtschiger– und leitete aus der Bundesverfassung den Auftrag ab, in den Wohnungsmarkt zugunsten der Schwächeren einzugreifen. Gleich in der Präambel heißt es nämlich, «dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen.»

«Kettensäge nicht das Modell für die Schweiz»
Einseitigem Marktvertrauen erteilte auch IAZI-Gründer und Kantonsrat Donato Sconamiglio eine Absage. «Die Kettensäge ist nicht das Modell für die Schweiz», sagte er. Schliesslich hänge die hohe Standortqualität hierzulande auch mit der hohen Regelungsdichte zusammen, und gerade die Betuchteren hätten kein Interesse daran, dass die tieferen Einkommensgruppen keine Wohnung fänden.

Ein weiterer Konsens an diesem Abend: Die grossen Immobilienfirmen taugen nicht als Feindbild. Immobilien-Aktiengesellschaften besitzen gerade einmal 1% der vermieteten Wohnungen, und von den 21 % der Schweizer Mietwohnungen, die in der Hand von Institutionellen sind, entfällt der grösste Teil auf die Pensionskassen. Bei denen geht es bekanntlich nicht um Gier nach Maximalrenditen, sondern um die Altersvorsorge für breite Schichten der Gesellschaft. Eine bessere Kommunikation der Branche wäre also angebracht. Kucher forderte die Unternehmen auf, mehr für die mediale Sichtbarkeit zu tun. Wichtig aber auch: Die Kraft zu Kompromissen, die laut Bärtschiger zufolge früher ausgeprägter war, sollte wieder wachsen. Angesichts der sozialen Dimension der Wohnungsfrage resümierte Christian Kraft: «Wir müssen uns aufeinander zubewegen».